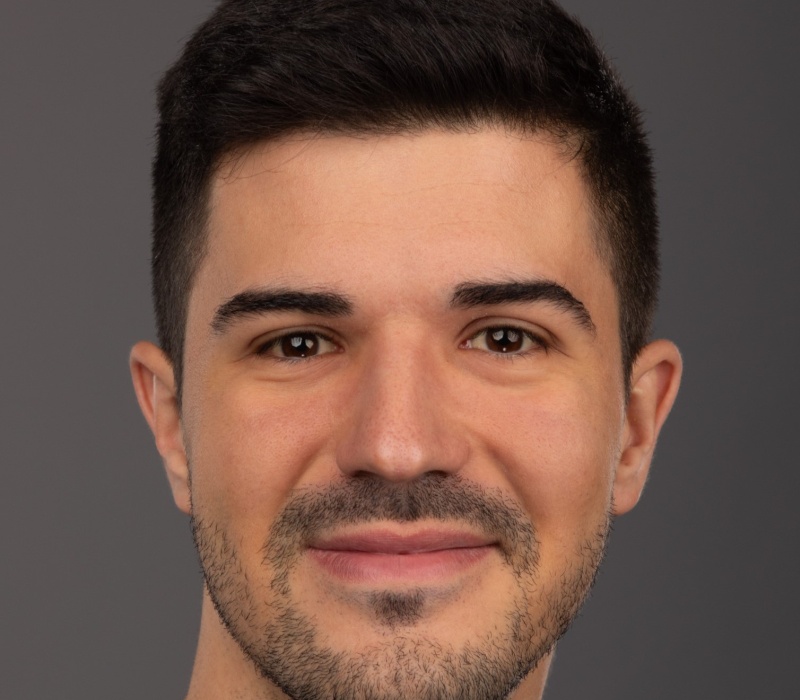Mobilitätsvision Neulengbach
Kleinstädte am Rande des suburbanen Raumes
Dass ein Bereich existiert, der nicht deutlich zu den Begriffen Stadt oder Land zuordenbar ist, zeigte SIEVERTS (1999³) mit dem Konzept der Zwischenstadt auf. (vgl. HILPERT et al. 2018: 111; vgl. LICHTENBERGER 1998³: 15; vgl. SIEVERTS 1999³: 14f.) Eine große Herausforderung von diesen Kleinstädten ist, dass sie und deren Zentren häufig unzureichend durch ÖPNV (= Öffentlicher Personennahverkehr) sowie durch Infrastruktur aktiver Mobilität (Fuß- und Radverkehr) ausgestattet sind, sodass sich zeitgemäße Mobilitätsformen nur schwer durchsetzen können und in Kleinstädten noch immer der Trend zu einem Zweitauto-Besitz besteht.
Da ein Ziel der Verkehrsplanung ist, „mehr Mobilität und weniger Verkehr“ (TOPP 2003: 292) zu schaffen und Megatrends wie der Klimawandel zu einer Systemveränderung führen können, erkennen immer mehr Gemeinden die Wichtigkeit eines integrierten Mobilitätskonzeptes – so auch die Gemeinde Neulengbach, die das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit darstellt. Neulengbach, eingebettet im Wienerwald, ist eine Kleinstadt bestehend aus 15 Katastralgemeinden mit insgesamt 8.304 Einwohner*innen (Stand 01.01.2020) (vgl. STATISTIK AUSTRIA 2020a: 89), die ab dem Jahre 2021 die Erstellung eines zeitgemäßen Mobilitätskonzeptes in Auftrag geben werden.
Zentrale Herausforderungen in der kleinen Zwischenstadt Neulengbach betreffen vor allem die starke Zersiedelung der Bevölkerung und die Weitläufigkeit sowie Topographie des Gemeindeareals, was zu einer verstärkten Abhängigkeit zum eigenen PKW führt und weder eine flächendeckende Erschließung durch liniengebundenen ÖPNV noch durch ein Rad- und Fußwegnetz ermöglicht.
Mangelnde Infrastrukturausstattung für alternative Mobilitätsformen, insbesondere für den Fuß- und Radverkehr, führt zu einer geringen Verkehrssicherheit für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen bzw. für bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Kinder und Jugendliche. Die bestehenden Herausforderungen sollen mit vier definierten Handlungsfeldern, denen sich im Erstellungsprozess des Mobilitätskonzeptes weiter gewidmet wird, gelöst werden. Übergreifend ist anzustreben, für Planungen einen Einbezug der Bevölkerung anzustreben. In einem ersten Schritt soll die verkehrsträgerübergreifende Erreichbarkeit von zentralen Orten der Gemeinde verbessert werden, bevor im nächsten Schritt Verkehr um die Kernstadt beruhigt wird.
Text Claudio Link

Fragestellungen
- Die Mobilitätssituation rund um die Neulengbacher Kernstadt spielt bei einer Attraktivitätssteigerung eine wichtige Rolle
- Mobilitätsbezogene Herausforderungen ergeben sich durch die starke Zersiedelung der Gemeinde
- Neulengbach stellt ein wichtiges Zentrum für die Gemeinden der Wienerwald Initiativ Region dar
- Verkehr in Neulengbach entsteht bislang für MIV (motorisierter Individualverkehr) Nutzer*innen
- Der Fokus eines Mobilitätskonzeptes sollte vor allem auf im Kontext Mobilität benachteiligten Bevölkerungsgruppen liegen
Handlungsfelder
- Wir beziehen ein… Handlungsfeld Einbezug der breiten Öffentlichkeit
- Wir schaffen Erreichbarkeit… Handlungsfeld Erreichbarkeit mit allen Verkehrsträgern
- Wir beruhigen… Handlungsfeld Verkehrsberuhigung
- Wir schaffen Oasen… Handlungsfeld Aufenthaltsqualität, urbanes Grün und Klimawandelanpassung



Schlussfolgerungen
Die Analysen dieser Arbeit haben gezeigt, dass Neulengbach eine leicht wachsende Kleinstadt ist, für die in den nächsten zehn bis 15 Jahren ein weiteres leichtes Bevölkerungswachstum prognostiziert wird. Bisheriges und zukünftiges Bevölkerungswachstum ist vor allem auf eine positive Wanderungsbilanz zurückzuführen. Aufgrund der nahen Lage zu der Metropole Wien und der Mittelstadt St. Pölten und der ländlich geprägten Landschaft ist Neulengbach als beliebtes Siedlungsgebiet am Rande des suburbanes Gebietes zu betrachten. Die Bevölkerung Neulengbachs ist auf 43 Ortschaften aufgeteilt, was zu einem stark zersiedelten Ortsbild führt, Altersklassen der Bevölkerung verlagern sich langsam hin zu älteren Altersgruppen, was zeigt, dass eine zunehmende Alterung der Bevölkerung wie in vielen anderen Gemeinden, Regionen und ganzen Industriestaaten besteht.
Haushalts- und Familienstrukturen Neulengbachs unterscheiden sich nur wenig zu jenen Strukturen umliegender Gemeinden bzw. Gemeinden des Landes Niederösterreich. Die auf die demographische Analyse aufbauende Ausstattungsanalyse hat gezeigt, dass Infrastruktur besonders für den MIV stark ausgebaut ist, was sich mit Herausforderungen, die in kleinstadtbezogener Literatur genannt werden, deckt. ÖPNV-Infrastruktur ist entlang der Verkehrsachse Wien – St. Pölten über die innere Westbahnstrecke besonders gut ausgebaut und bietet hier vor allem für Pendler*innen und Schüler*innen ein adäquates Angebot. Da Pendler*innenströme vor allem nach Wien und St. Pölten stark ausgeprägt sind, stellt die innere Westbahn für die Bewältigung dieser Wege ein enorm wichtiges ÖPNV-Verkehrsmittel dar. Abseits von Verkehrsachsen ist die ÖPNV-Infrastruktur jedoch lückenhaft, auch die Infrastruktur für aktive Mobilität kann als lückenhaft angesehen werden. Eine detailliertere Betrachtung der Zentrumszone und der Kernstadt hat gezeigt, dass selbst in zentralen Bereichen der Stadtgemeinde Lücken in der Infrastruktur für ÖPNV und aktive Mobilität (Anm.: Fußwege, Radwege) bestehen.
Im Beteiligungsprozess wurden von teilnehmenden Personen Mobilitätsschwachpunkte vor allem in den Bereichen der mangelnden Ausstattung mit Infrastruktur aktiver Mobilität und der mangelnden Verkehrssicherheit genannt. Während sich die Herausforderung der mangelnden Ausstattung mit Fuß- und Radinfrastruktur mit in Literatur gefundenen Problemfeldern von Kleinstädten deckt, ist die Verkehrssicherheit ein Aspekt, der in Literatur kaum genannt wird, jedoch aufgrund des Stimmungsbildes der teilnehmenden Personen in Neulengbach eine bedeutende Rolle einnimmt. Mangelnde Verkehrssicherheit ist dabei vor allem auf enge oder fehlende Gehwege sowie eine geringe Anzahl an sicheren Überquerungen über stark befahrene Straßen zurückzuführen und betrifft somit vor allem Fußgehende.
Von Bürger*innen aufgezeigte Lösungswege betreffen daher die Schaffung von Überquerungsmöglichkeiten, Implementierungen von Geschwindigkeitsbegrenzungen, beispielsweise durch bauliche Maßnahmen und die Errichtung von Gehwegen. Im Bereich der aktiven Mobilität steht für die Teilnehmer*innen eine Vernetzung des bestehenden Radwegnetzes und eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität der Kernstadt im Zentrum.
In der kleinen Zwischenstadt Neulengbach betreffen die essenziellen Herausforderungen zunächst die Topographie und die Weitläufigkeit des Gemeindeareals, wodurch für Teile der Bevölkerung weite Distanzen überwunden werden müssen, um zu zentral gelegenen Orten zu gelangen. Diese Wege sind daher nicht in allen Fällen durch aktive Mobilitätsformen zurücklegbar und aufgrund von lückenhaften ÖPNV-Systemen können diese Wege ebenfalls schwer mittels ÖV zurückgelegt werden. Eine weitere Herausforderung, die aus dem Mangel an alternativen Fortbewegungsarten entsteht, ist die Abhängigkeit vom Zweitauto, die laut Expert*innen in Neulengbach besteht und daher ebenfalls als zentral gesehen werden kann. Die starke MIV-Abhängigkeit führt zu einem weiteren Konfliktfeld, das die Innenstadt bzw. Kernstadt betrifft: Ruhender Verkehr wird generell als ein Aspekt mit viel Konfliktpotenzial im Verkehr gesehen, in punkto Verkehrsberuhigung bzw. Parkraumbewirtschaftung besteht in der Gemeinde die Kontroverse, dass einerseits eine Verkehrsberuhigung der Kernstadt angestrebt werden soll, aber dass auf der anderen Seite eine berechtigte Sorge herrscht, dass durch eine Parkraumbewirtschaftung Kaufkraft aus dem Zentrum abfließen könnte.
Eine Verkehrsberuhigung oder Parkraumbewirtschaftung durchzuführen, ohne zuvor eine bessere Erreichbarkeit mit alternativen Mobilitätsformen zu schaffen bzw. ohne die Gestaltungsqualität der Kernstadt zu stärken, kann daher das eben genannte Konfliktfeld bestärken. Expert*innen beschrieben, dass Gewohnheiten der Bevölkerung wie die Nutzung des eigenen PKWs und das Parken in der Kernstadt nur schwer zu ändern sind und, dass diese sich nur ohne Zwang ändern sollten. Daher wird es als zentral angesehen, ausgewählte Personen aus der Bevölkerung und Wirtschaftstreibende bei derartigen Planungen miteinzubeziehen und daher früh ein Bewusstsein für mögliche Umsetzungsvarianten einer Parkraumbewirtschaftung zu schaffen, was auch im Rahmen der Erstellung eines Mobilitätskonzeptes einen wichtigen Punkt darstellt. Welche weiteren Anforderungen, auf all die genannten Überlegungen aufbauend, an ein Mobilitätskonzept der Gemeinde Neulengbach bestehen, wurde im Rahmen von Handlungsfeldern beschrieben.
Ein essenzieller Punkt ist es dabei, Erreichbarkeit von zentralen Punkten wie der Zentrumszone mit allen Verkehrsträgern zu forcieren. Im nahen Umfeld der Zentrumszone spielt aktive Mobilität dabei eine große Rolle, wozu im betreffenden Handlungsfeld mehrere mögliche Projektumsetzungen genannt wurden. Radwegevernetzungen und die Erstellung eines Fußwegleitsystems besitzen hierbei eine hohe Priorität und können leicht umgesetzt werden. Die langfristige Schaffung eines weiteren, leistungsfähigeren bedarfsorientierten Verkehrs steht hier ebenso im Zentrum. Im Anschluss an die Verbesserung von Erreichbarkeit kann eine Verkehrsberuhigung der Kernstadt angestrebt werden, um das Ortsbild attraktiver zu gestalten und mehr Raum für Fußgehende und Radfahrende zu schaffen bzw. konsumfreie Räume zum Verweilen zu schaffen. Eng verknüpft ist dieses definierte Handlungsfeld der Verkehrsberuhigung mit dem Handlungsfeld Klimawandelanpassung, das auch in einem Mobilitätskonzept berücksichtigt werden sollte und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität von Ortszentren stärken kann.
Aufbauend auf die eben zusammengefassten Ergebnisse stellt sich nun die Frage, ob die definierte Forschungsfrage und die zugehörigen forschungsleitenden Hypothesen vollständig beantwortet werden konnten. Ziel der Masterarbeit war es, folgende Forschungsfrage zu beantworten: Welche zentralen, verkehrsbezogenen Herausforderungen bestehen in der kleinen Zwischenstadt Neulengbach und welche Anforderungen entstehen dadurch an ein modernes Mobilitätskonzept der Gemeinde? Zentrale Herausforderungen wurden in Tabelle 10 in Kap. 6.3.2, aufbauend auf die Literaturanalyse, Meinungen aus dem Beteiligungsprozess dieser Arbeit und Expert*innen im Rahmen der Leitfadeninterviews, definiert und werden für Neulengbach als zentral angesehen. Herausforderungen betreffen eine starke Autoabhängigkeit, insbesondere die Abhängigkeit vom Zweitauto und die mangelnde Ausstattung durch ÖPNV, auch bedingt durch eine starke Zersiedelung. Zentral ist ebenso ein Mangel an Infrastruktur für aktive Mobilitätsformen bzw. Fuß- und Radwege, die als unsicher und unattraktiv wahrgenommen werden. Dieser Punkt führt zu einer geringen Barrierefreiheit und zu einer geringen (subjektiven) Verkehrssicherheit für Fußgehende und Radfahrende. Besonders Kinder, Jugendliche und Senior*innen sind als Verkehrsteilnehmer*innen dadurch gefährdet.
Dass diese Herausforderungen ebenfalls in anderen kleinen Zwischenstädten bestehen, wird vermutet, kann aber ohne weiterführende Forschungen empirisch nicht bestätigt werden. Welche Kleinstädte Österreichs neben Neulengbach zu dem Kleinstadttyp der kleinen Zwischenstadt zu zählen sind und ob diese den gleichen verkehrsbezogenen Herausforderungen gegenüberstehen, wäre dabei ebenfalls zu prüfen. Der zweite Teil der Forschungsfrage, der sich damit beschäftigt, welche Anforderungen an das Mobilitätskonzept Neulengbachs bestehen, konnte im Rahmen der Forschung durch die Handlungsempfehlungen beantwortet werden, die einerseits theoretische Aspekte und Analyseschritte, aber auch Meinungen aus der Bevölkerung und Expert*innenmeinungen miteinbeziehen und mögliche Mobilitätslösungen aufzeigen. Die Hypothesen können zu einem Teil bestätigt werden, so beziehen sich die größten verkehrsbezogenen Herausforderungen der Kleinstadt auf das hohe Maß an Zersiedelung. Verkehrsinfrastrukturen sind, wie die Ausstattungsanalysen und Expert*innenmeinungen gezeigt haben, stark auf den MIV ausgelegt, der ÖPNV ist abseits der inneren Westbahnstrecke stark unterrepräsentiert.
Es kann ebenso, unter anderem aus finanziellen Gründen, als sinnvoll angesehen werden, ein Mobilitätskonzept als Schwerpunktkonzept aufzubauen, damit sich zielgerichtet mit den wichtigsten Problemfeldern einer Gemeinde auseinandergesetzt werden kann. Zwei Hypothesen können jedoch widerlegt werden. Die Anforderungen an ein Mobilitätskonzept sind auch von demographischen Parametern abhängig, jedoch können andere infrastrukturelle Parameter wie die Ausstattung mit Infrastruktur und die bestehenden Strukturen des Zentrums als wesentlicher angesehen werden, weswegen die Hypothese widerlegt werden kann. Widerlegt werden kann ebenso, dass im Rahmen eines Partizipationsprozesses die breite Öffentlichkeit durch einen konsultativen Beteiligungsprozess miteinbezogen werden soll. Eine intensivere Einbeziehung ausgewählter Personen durch einen kooperativen Beteiligungsprozess kann zu besser akzeptierten Maßnahmen und Projekten führen. Weiters kann eine der Hypothesen nicht vollständig beantwortet werden, Strukturen von Kleinstädten in Österreich können laut der Literaturrecherche als heterogen angesehen werden und sich durch die in Tabelle 1 gezeigten Parametern voneinander unterscheiden, jedoch kann durch diese Arbeit nicht gezeigt werden, in welchem Ausmaß die Heterogenität vorhanden ist.
Diese Arbeit kann als Vorstudie zu der Durchführung des Mobilitätskonzeptes von Neulengbach gesehen werden, weshalb weiterführende Forschung im Rahmen des Konzeptes sinnvollerweise auf diese Arbeit aufbauen soll. Um eine bewusste Weiterführung der Forschung zu ermöglichen, wurden im Kapitel der Handlungsempfehlungen Fragestellungen erarbeitet, mit denen sich die Gemeinde sowie Planer*innen weiter befassen sollen. Diese Masterarbeit greift zusätzlich eine kleinstadtbezogene Forschungslücke im Bereich der Grundlagenforschung auf und schafft durch eine Einordnung Neulengbachs in einer Kleinstadttypisierung eine Einbettung von Ergebnissen der Fallstudie, die auf ähnliche Kleinstädte übertragen werden können. Eine z.B. bundesweite Aufstellung einer Kleinstadttypisierung stellt einen Weg dar, um Grundlagenforschung weiter fortzuführen.
Masterarbeit Mobilitätsvision Neulengbach Claudio Link Download ...
Danksagung